Psychische Erkrankungen

In Verbindung zu bleiben, ist das Allerwichtigste – auch wenn es bei einem psychisch kranken Partner immer wieder Momente gibt, wo es weh tut, einander offen zu begegnen.
Menschen mit psychischen Erkrankungen wünschen sich im Kern dasselbe wie alle anderen: Nähe, Verbundenheit, Freiheit zur persönlichen Entwicklung – und eine Beziehung, die trägt und Sinn gibt. Doch wenn eine psychische Störung chronisch wird, gerät genau dieses Beziehungsfundament unter Druck. Symptome, Krisen und Rückzüge stören das Gleichgewicht. Ressourcen schwinden – auf beiden Seiten. Das führt zu Missverständnissen, Erschöpfung, Zorn. Und nicht selten zum Gefühl: „Ich werde nicht mehr gesehen.“
Viele Partnerschaften zerbrechen daran. Aber längst nicht alle.
Denn es gibt auch sie: Paare, die trotz – oder gerade mit – einer psychischen Erkrankung eine stabile, manchmal sogar wachsende Beziehung führen. Sie finden Wege, mit den Herausforderungen umzugehen. Sie entwickeln eine andere Form von Kommunikation, von Fürsorge – und von gegenseitiger Verantwortung.
Paartherapie kann dabei eine Schlüsselrolle spielen. Sie hilft, Dynamiken zu verstehen, Kommunikation zu verbessern – und die Beziehung so zu gestalten, dass beide darin atmen können.
Wissenschaftliche Studien zeigen: In sehr vielen Fällen profitieren beide – der erkrankte Partner und die Beziehung – gemessen z.B. der Partnerschafts-Zufriedenheit. Das gilt besonders, wenn die emotionsfokussierte Paartherapie (EFT-P) oder die Cognitive-Behavioral Conjoint Therapy (CBCT) zum Einsatz kommen:
- Randomisierte kontrollierte Studie von Wittenborn et al. (2019). Er verglich Paare mit einem depressiv erkrankten Partner einmal nach EFT-P und einmal nach üblicher Paar-Gesprächstherapie. Das Ergebnis: Paare in der EFT-Gruppe zeigten signifikant größere Verbesserungen sowohl in der Partnerschaftszufriedenheit als auch – bei den männlichen Partnern – in depressiven Symptomen gegenüber der Kontrollgruppe.
Journal of Marital and Family Therapy, 45(4), 561–575. - Randomisierte Studie von Monson et al. (2015). Die Autoren verglichen die Ergebnisse einer CBCT-Paartherapie bei posttraumatischer Belastungsstörung mit Wartelisten-Kontrollgruppen. Mit CBCT kam es zu starken Rückgängen bei PTBS-Symptomen und deutlich erhöhten Verbesserungen der Partnerschaftszufriedenheit.
Journal of the American Medical Association, 308(7), 700–709 - Meta-Analyse von Spengler et al. (2022) von 20 Studien mit insgesamt 332 Paaren mit psychischer Erkrankung mindestens einer der Partner. Ergebnis: Rund 70 % der Paare waren beim Therapieabschluss symptomfrei – ein sehr starker Befund.
Comprehensive Meta-Analysis on the Efficacy of Emotionally Focused Couple Therapy
Paartherapie bei Depression
Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen – etwa ein Drittel aller Menschen in Deutschland erkrankt mindestens einmal im Leben an einer behandlungsbedürftigen depressiven Episode. Ihre Auswirkungen machen auch vor Paarbeziehungen nicht halt.
Ist ein Partner betroffen, verändert sich die emotionale und körperliche Dynamik der Beziehung oft erheblich – nicht weil er es will, sondern weil die Erkrankung es mit sich bringt. Die depressive Störung greift tief in das Miteinander ein, schränkt Kommunikation, Nähe und gemeinsame Lebensgestaltung ein – und überfordert nicht selten beide Seiten.
Leidet ein Partner unter einer Depression, dann:
- ist seine Stimmung über Wochen oder Monate gedrückt oder wie abgeschnitten
- wirkt er niedergeschlagen, innerlich leer oder gereizt
- fehlt ihm der Antrieb – selbst für kleine Dinge
- verliert er das Interesse an Berührung, Nähe und Sexualität
- zieht er sich aus dem Familienleben zurück, z. B. aus der Kinderbetreuung oder Haushaltsverantwortung
- vernachlässigt er manchmal sogar Körperpflege, Ernährung oder soziale Kontakte
- fällt es ihm schwer, überhaupt emotionale Signale zu senden oder zu empfangen.
Diese Symptome kränken den nicht betroffenen Partner oft tief – nicht, weil die Liebe fehlt, sondern weil Nähe nicht mehr erreichbar scheint. Das führt leicht zu Missverständnissen, Schuldgefühlen oder gegenseitiger Überforderung.
Depression und Bindung – eine emotionale Entkoppelung
In der emotionsfokussierten Paartherapie (EFT) verstehen wir depressive Rückzüge nicht als Ablehnung, sondern oft als Selbstschutz: Der Betroffene fühlt sich wertlos, „nicht mehr zumutbar“ oder emotional unerreichbar. Genau das unterbricht jedoch den emotionalen Kreislauf der Bindung – und triggert beim gesunden Partner häufig Verlassensangst, Wut oder Rückzug.
Was entsteht, ist eine schmerzhafte Distanz: beide fühlen sich unverstanden – und ziehen sich immer weiter zurück.
Was hilft?
Anerkennen was ist. Depressionen sind eine Krankheit. Das abweisende Verhalten des erkrankten Partners ist keine Folge fehlender Liebe – sondern Symptom einer behandlungsbedürftigen Störung. Diese Entlastung hilft beiden Seiten, die Schuldzuschreibungen zu stoppen.
Akuttherapie vor Paartherapie. In der akuten Phase steht die Stabilisierung im Vordergrund – mit medizinischer Behandlung (z. B. Antidepressiva) und Einzeltherapie. Erst wenn eine erste Besserung erreicht ist, wird eine Paartherapie sinnvoll.
Paartherapie als Stabilisierungsraum. Ist der erkrankte Partner raus aus der akuten depressiven Phase, kann eine begleitende Paartherapie unterstützend wirken, in dem sie:
- das wechselseitige Verständnis fördert
- bewährte Beziehungsroutinen wiederherstellt
- körperliche und emotionale Nähe neu aufbaut
- Kommunikationsmuster verbessert (z. B. Offenheit statt Rückzug).
Achtsamkeit für Belastungsgrenzen. In manchen Fällen überfordern die in den Paartherapie-Sitzungen erlebten Emotionen den depressiven Partner. Dann ist eine Pause sinnvoll – oder eine Kombination mit Einzelgesprächen.
Fazit
Paartherapie unterstützt die Beziehung – nicht statt, sondern ergänzend zur Depressionsbehandlung. Wenn beide Partner verstehen, wie die Erkrankung wirkt – und was sie mit ihrer Beziehungsdynamik macht – entsteht wieder Spielraum: für Mitgefühl, für Nähe, für den gemeinsamen Alltag.

Körperlich in Kontakt zu bleiben, etwa durch Berühren der Arme, kann für den depressiv erkrankten Partner wichtig sein. Aber Vorsicht: Was ihm gut tut beim Thema Nähe, ist nicht konstant. Gut ist deshalb, Annäherungen anzukündigen oder zu fragen, was sich der Partner aktuell wünscht.

Eine bipolar erkrankte Partnerin zu erreichen, ist immer wieder eine Herausforderung.
Paartherapie bei bipolarer Störung
Bipolare Störungen stellen für jede Paarbeziehung eine große Herausforderung dar. Die extremen Schwankungen zwischen manischer Hochstimmung und depressivem Rückzug bringen beide Partner an ihre Grenzen – emotional, organisatorisch, finanziell und nicht selten auch körperlich.
Für den nicht betroffenen Partner ist der Alltag oft geprägt von Unsicherheit: Was kommt als Nächstes? Wie lange hält diese Phase an? Was ist noch Teil der Persönlichkeit – und was bereits Symptom der Erkrankung?
Die manische Phase – Aufschwung mit Risiken
In manischen Phasen ist der betroffene Partner euphorisch, rastlos, impulsiv und wenig schlafbedürftig. Er oder sie redet viel, trifft überstürzte Entscheidungen und überschreitet häufig Grenzen – auch innerhalb der Beziehung.
- Der betroffene Partner ist euphorisch, umtriebig und unruhig.
- Er oder sie redet viel, hat wenig Schlafbedarf und trifft riskante Entscheidungen. Oft werden in kurzer Zeit große Geldmengen verbraucht.
- Der oder die betroffene fordert vom Partner Sex ein und/oder sucht Sexualkontakte mit Dritten und zeigt dabei keine Hemmungen.
- Auch die Sexualität ist häufig verändert: Es kommt zu vermehrtem sexuellen Verlangen, aufdringlichem Verhalten oder Außenbeziehungen.
- Wenn der gesunde Partner – oder auch der Arbeitgeber – bremst oder Grenzen setzt, droht die Eskalation mit offen gezeigter Aggression oder körperlicher Gewalt.
- Nicht selten verlieren die Betroffenen durch solches Fehlverhalten ihren Arbeitsplatz – und wenn es ganz schlecht läuft, den Partner.
Die depressive Phase – Rückzug in die Leere
Die manische Hochstimmung wird entweder abrupt oder schleichend von einer depressiven Phase abgelöst. Manchmal schiebt sich zwischen beide Extreme auch eine symptomarme Zwischenperiode.
- Der betroffene Partner ist über Wochen und Monate bedrückt, zurückgezogen und kraftlos.
- er/sie ist antriebsarm und hat zu nichts Lust (Anhedonie).
- Er/sie verbringt die meiste Zeit allein. Zärtlichkeit und Nähe erscheinen unerreichbar. Der Alltag bleibt an der gesunden Bezugsperson hängen, die sich häufig alleingelassen fühlt.
- Das sexuelle Interesse ist oft komplett erloschen.
- Er/sie zieht sich von sozialen Aktivitäten wie z.B. der Kinderbetreuung zurück, vernachlässigt Einkaufen, Kochen und Essen.
- Er/sie vernachlässigt die Hygiene und die Körperpflege.
Beziehungsdynamik zwischen Kontrollverlust und Erschöpfung
Die unvorhersehbaren Wechsel fordern die Partnerschaft permanent heraus. Viele Angehörige entwickeln eigene Strategien, um mit der Instabilität umzugehen – von Überverantwortlichkeit bis hin zu emotionalem Rückzug.
In der emotionsfokussierten Paartherapie zeigt sich häufig: Die Beziehung leidet nicht nur an den Symptomen, sondern auch an der schwindenden emotionalen Sicherheit. Der nicht betroffene Partner fragt sich: „Kann ich mich auf ihn/sie verlassen?“ Der erkrankte Partner fühlt sich gleichzeitig oft beschämt, überfordert – oder unfair behandelt.
Was hilft?
Anerkennen, was ist. Eine bipolare Störung ist eine schwere chronische Erkrankung mit oft ungünstiger Prognose. Beide Partner brauchen die Erlaubnis, dies auszusprechen – ohne Schuld oder Vorwurf.
In akuten Phasen einer bipolaren Störung, egal ob Manie oder Depression, steht die Stabilisierung und Symptomlinderung des betroffenen Partners im Vordergrund. Dies gelingt insbesondere in der manischen Phase oft nur teilweise, auch verweigert der manisch Erkrankte nicht selten die erforderlichen Arztbesuche und die erforderlichen Medikamente.
Der behandelnde Psychiater bittet dann oft ersatzweise mit dem Partner um Mitwirkung, etwa damit die Medikamente eingenommen werden. Nicht selten muss der Betroffene irgendwann dann doch in eine Nervenklinik.
Paartherapie in stabilen Phasen. Die Zeit zwischen den Phasen ist die beste Zeit für Paartherapie. Hier kann:
- Verständnis für das Krankheitsbild aufgebaut werden
- Kommunikation gestärkt und Rollen reflektiert werden
- Belastungsgrenzen definiert und Vereinbarungen getroffen werden.
Emotionale Sicherheit wiederherstellen. Ziel der Therapie ist nicht nur der bessere Umgang mit Symptomen – sondern auch die Wiederherstellung von Bindung: gegenseitiges Verständnis, ehrliche Gespräche, wieder erlebbare Intimität. Das ist möglich – aber nur mit Geduld, realistischer Erwartung und professioneller Begleitung.
Fazit
Die Paartherapie ist kein Allheilmittel – aber ein stabilisierender Raum. Viele Beziehungen mit einem bipolar erkrankten Partner scheitern – aber nicht alle. Wenn es gelingt, über die Symptome hinaus miteinander im Kontakt zu bleiben, können auch diese Beziehungen gelingen. Entscheidend ist, dass niemand alleine gelassen wird – weder der Erkrankte noch der oft nicht minder leidende, nicht betroffene Partner.
Paartherapie in Augsburg
Manchmal braucht es nur einen ersten Schritt, um wieder zueinanderzufinden. Meldet euch gerne und wir schauen gemeinsam, wie ich euch unterstützen kann.
Paartherapie bei Posttraumatischer Belastungsstörung
Eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine schwere psychische Reaktion auf ein extremes Belastungserlebnis – wie Gewalt, Missbrauch, schwerer Unfall, Krieg oder Vernachlässigung. Aber auch wiederholte, „unspektakuläre“ Traumatisierungen wie emotionale Vernachlässigung in der Kindheit oder erzwungener Geschlechtsverkehr in der Beziehung können langfristig traumatisieren und zur PTBS führen.
Typische Belastungen für die Partnerschaft
PTBS beeinflusst nicht nur das Innenleben der betroffenen Person, sondern auch die Partnerschaft – tief, komplex und oft schwer verständlich.
- Flashbacks: Unwillkürliche, belastende Erinnerungsbilder oder Sinneseindrücke, die das Trauma im Kopf wieder „erleben“ lassen – oft ausgelöst durch scheinbar harmlose Reize.
- Hypervigilanz: Hypervigilanz bezeichnet übermäßige Wachsamkeit und ständige innere Alarmbereitschaft. Sie ist häufig begleitet von Schlafstörungen, Erschöpfung und Konzentrationsproblemen.
- Reizbarkeit und Wutausbrüche: Viele Betroffene reagieren auf kleinste Belastungen übermäßig heftig – für den Partner oft unvorhersehbar, beängstigend und verletzend.
- Nicht-aushalten-können von emotionaler Nähe: Nähe wird gesucht – und in Momenten auch genossen. Doch sie kann ebenso abrupt wieder abbrechen, etwa durch Rückzug, Erstarren oder das plötzliche Bedürfnis nach Distanz.
- Misstrauen und erhöhtes Kontrollbedürfnis: Betroffene zeigen häufig kontrollierendes Verhalten, um sich selbst vor Unsicherheit oder emotionaler Überwältigung zu schützen. Das macht ein spontanes soziales Leben – etwa mit Freunden oder Kindern – oft fast unmöglich.
- Probleme mit Intimität: Besonders nach sexualisierten Traumata ist der Körper kein sicherer Ort mehr. Berührungen, Gerüche oder bestimmte Situationen können intensive Angst oder Abwehr hervorrufen – auch innerhalb einer liebevollen Beziehung.
EFT-Perspektive: Schutzverhalten statt Ablehnung
Die emotionsfokussierte Paartherapie versteht solche Reaktionen nicht als Ablehnung, sondern als emotionalen Selbstschutz. Der betroffene Partner zieht sich nicht zurück, weil ihm etwas an der Beziehung fehlt – sondern weil Nähe unkontrollierbare Gefühle auslöst. Er „sichert sich selbst“, ohne es zu wollen – und der andere fühlt sich zurückgewiesen, hilflos oder irgendwann auch innerlich distanziert.
Was hilft?
Wissen über die PTBS: Beide Partner sollten sich über PTBS informieren, um ein besseres Verständnis der komplexen Erkrankung zu entwickeln und ihre Erwartungen an die Beziehung anpassen.
Grenzen setzen: Beide Partner müssen dem Anderen Grenzen setzen und die Grenzen des Anderen akzeptieren, um sich emotional zu schützen und die Beziehung zu erhalten.
Stabilisierung statt Konfrontation. Der Fokus liegt nicht auf dem Trauma selbst, sondern auf Sicherheit: Was triggert? Wie gelingt Beruhigung? Wie viel Nähe ist möglich – ohne Überforderung?
Individuelle Traumatherapie ist Voraussetzung. Verfahren wie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), körperorientierte Methoden oder stabilisierende Traumatherapie (z. B. nach Reddemann oder sensomotorisch orientiert) sind essentiell, um die traumatische Erfahrung überhaupt verarbeiten zu können.
Eine Paartherapie kann anschließend oder begleitend zur Traumatherapie viel Gutes bewirken – sie ersetzt die Traumatherapie aber nicht. Ein wichtiges Thema in der Paartherapie ist, emotionale und körperliche Nähe behutsam neu zu verhandeln. Was ist inzwischen möglich – jetzt, in dieser Phase? EFT bietet einen sicheren Rahmen, um vorsichtig wieder Verbundenheit herzustellen – auf eine Weise, die die innere Verletzlichkeit berücksichtigt.
Unterstützung für den gesunden Partner. Viele übernehmen zu viel Verantwortung – oder ziehen sich aus Selbstschutz zurück. Die Paartherapie hilft dem gesunden Partner, Verantwortungsübernahme und Grenzen zu betrachten und neu zu sortieren. Diese Selbstfürsorge ist kein Egoismus, sondern Grundbedingung für eine langfristig tragfähige Beziehung mit dem betroffenen Partner. .
Fazit
PTBS verlangt Geduld – und genaue therapeutische Abstimmung
Paartherapie kann viel bewirken – wenn sie zum richtigen Zeitpunkt ansetzt. Sie bietet Orientierung, Halt und eine neue Sprache für Nähe und Abgrenzung. Und sie macht es möglich, dass beide Seiten sich wieder als „Team“ erleben – auch wenn Heilung ein Prozess in Etappen ist.

Partner mit posttraumatischer Belastungsstörung erscheinen ihrem nicht-betroffenen Partner oft verschlossen und geradezu undurchdringlich. Er oder sie rätselt, was im (betroffenen) Partner vorgeht und warum sich die Emotionen immer wieder ändern.

Gemeinsam Essen ist für einen Menschen mit Essstörung eine schwierige Angelegenheit – dahinter steht nicht selten die Angst, dass das “krankhafte” Essverhalten beobachtet oder gar zum Gesprächsthema gemacht wird. Gemeinsam kochen geht aber oft ganz unkompliziert.
Paartherapie bei Essstörung
Essstörungen sind schwere psychische Erkrankungen mit hoher Chronifizierungs- und Rückfallgefahr. Sie betreffen fast immer nicht nur die betroffene Person selbst – sondern auch ihre Partnerschaft. Das gestörte Verhältnis zu Essen, Körper und Kontrolle wirkt tief in das Beziehungssystem hinein.
Die drei häufigen Essstörungen sind:
- Anorexia nervosa (Magersucht): massive Gewichtsabnahme durch restriktives Essverhalten, oft mit Körperschemastörung
- Bulimia nervosa: Essattacken mit anschließendem Erbrechen oder anderen kompensatorischen Maßnahmen wie exzessivem Sport oder Einnahme von Laxanzien (Abführmittel).
- Binge-Eating-Störung: regelmäßige Essanfälle ohne Gegenmaßnahmen – oft mit Schuldgefühlen und starkem Kontrollverlust.
- Mischformen sind häufig, Übergänge fließend.
Auswirkungen auf die Beziehung: komplex und vielschichtig
Essstörungen beeinflussen den Alltag und die Dynamik einer Beziehung stark:
Emotionale Distanzierung. Die Gedankenwelt kreist obsessiv um Kalorien, Kontrolle, Gewicht. Für Zärtlichkeit, Intimität oder unbeschwerte gemeinsame Zeit bleibt kaum Raum.
Scham- und Rückzugsmuster: Viele Betroffene schämen sich für ihr Verhalten – und ziehen sich innerlich zurück, ohne sich erklären zu können.
Gestörte Körperwahrnehmung und Intimität. Die intensive Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper (Körperschemastörung) führt auch dazu, dass die sexuelle Beziehung und andere Formen der Intimität in der Beziehung kaum vorhanden oder stark beeinträchtigt sind. So sind Angst vor körperlicher Nähe sowie sexuelle Dysfunktionen nicht ungewöhnlich.
Schwankungen in der Stimmung und im Verhalten. Essstörungen können zu signifikanten Stimmungsschwankungen führen, die durch unregelmäßige Essgewohnheiten und Nährstoffmangel verstärkt werden. Dies führt zu Reizbarkeit, Wutausbrüchen oder Depressionen, die die Partnerschaft belasten.
Soziale Isolation. Menschen mit Essstörungen meiden häufig soziale Aktivitäten, besonders natürlich Situationen, die mit Essen verbunden sind. Hier droht, dass der gesunde Partner mitzieht und sich beide zunehmend von Freunden und Familie entfernen.
Tipp: Sport in der Gruppe ist für Essgestörte manchmal akzeptabel – hier trifft die Leistungsorientierung vieler Essgestörter zusammen mit dem Hang, Kalorien zu verbrauchen.
Machtkämpfe um Essen und Kontrolle: Der gesunde Partner wird ungewollt zum Beobachter oder Kontrolleur – etwa beim Essen, Einkaufen oder Wiegen. Das erzeugt Spannungen, Rückzug oder offene Konflikte.
Geheimhaltung und Täuschung. Menschen mit Essstörungen neigen zu Täuschungen und Lügen – meist nicht aus böser Absicht, sondern aus Angst vor Kontrollverlust oder Bewertung. Leider untergraben die Lügen das Vertrauen des Partners oder der Partnerin..
EFT-Perspektive: Essverhalten als Schutzmechanismus in der Bindung
Aus Sicht der Emotionsfokussierten Paartherapie (EFT-P) ist die Essstörung oft eine emotional regulierende Strategie. Die Kontrolle über Nahrung, Gewicht oder Essverhalten hilft, innere Spannungen zu beherrschen – häufig im Zusammenhang mit unerkannten Bindungsverletzungen, die bis in die Herkunftsfamilie zurückreichen können.
Essstörungen entfalten ihre Dynamik nicht nur individuell, sondern massiv im Paarsystem. Oft werden Nähe, Kontrolle, Hilflosigkeit und Schuld regelrecht „verhandelt“ über das Essverhalten.
Paarbezogene Dynamik: Kontrolle, Hilflosigkeit und Bindungsverlust. In vielen Partnerschaften mit einem essgestörten Partner entwickelt sich ungewollt eine emotionale Schieflage: Der nicht betroffene Partner gerät in die Rolle des „Überwachers“ oder „Retters“, während die betroffene Person seine Autonomie verteidigt – oder sich zurückzieht.
Typisch ist der Versuch, das gefährdete Gegenüber durch Fürsorge zu stabilisieren: „Iss doch etwas“, „Du brauchst Hilfe“, „Ich mach mir Sorgen“. Doch diese gut gemeinten Interventionen werden häufig als Druck oder Kontrolle empfunden – und führen zum Rückzug oder zur (versteckten) Eskalation der Symptome.
Aus Sicht der EFT entstehen so klassische Teufelskreise:
- Der gesunde Partner spürt Angst und Überforderung → er wird kontrollierender oder fordernder.
- Die essgestörte Partnerin fühlt sich überfordert, beschämt oder eingeengt → sie zieht sich emotional zurück oder verschärft ihr Verhalten.
- Der gesunde Partner reagiert mit noch mehr Kontrolle oder Vorwürfen → und verstärkt ungewollt genau das, was er zu verhindern versucht.
Hinzu kommt: Viele Paare sprechen nicht über das, was wirklich darunter liegt – etwa Angst, Selbstwertkrisen, alte Verletzungen. Die Essstörung übernimmt die „Kommunikation“, ersetzt das Gespräch – und blockiert emotionale Verbindung.
EFT-Ziel: Aus dem Muster aussteigen, ohne Schuldzuschreibungen. In der Paartherapie können diese Muster sichtbar gemacht und entkoppelt werden. Die Partner lernen, die Emotionen unter dem Verhalten zu erkennen – etwa Ohnmacht statt Vorwurf, Scham statt Widerstand. So wird es möglich, einander wieder als verletzliche, erreichbare Menschen zu begegnen – und nicht als Problem oder Bedrohung.
Was hilft?
Begleitend zur individuellen medizinische-psychotherapeutischen Behandlung des Partners mit Essstörung ist eine Paartherapie ein hochsensibler, aber lohnender Weg
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Paartherapie bei Essstörungen:
- Der betroffene Partner muss zumindest teilweise einsichtsfähig und körperlich stabil sein – sonst ist die paartherapeutische Arbeit nicht möglich.
- Der gesunde Partner sollte bereit sein, sich mit seiner Rolle im Beziehungssystem des betroffenen Partners auseinanderzusetzen – ohne Schuld oder Retterhaltung.
- Die Paartherapeut:in braucht Erfahrung mit Essstörungen oder einen engen Austausch mit den medizinisch-psychotherapeutischen Therapeuten.
Wenn es gelingt, sich als Paar nicht in Kontrolle oder Ohnmacht zu verlieren, sondern neue Wege zu Nähe, Verständnis und Selbstfürsorge zu finden, kann die Paartherapie die Partnerschaft nicht nur stabilisieren – sondern auf Dauer stärken.
Paartherapie bei Alkoholabhängigkeit oder anderer Suchterkrankung
Suchterkrankungen – ob Alkohol, Medikamente, Cannabis oder andere Substanzen – gehören zu den häufigsten und folgenreichsten Belastungen für Partnerschaften. Sie betreffen nicht nur den Körper, sondern auch das Beziehungssystem: Vertrauen, Verlässlichkeit, emotionale Stabilität – all das gerät ins Wanken.
Häufig beginnt die Sucht schleichend – der Konsum entzieht sich zunehmend der Kontrolle. Oft passiert jahrelang nichts, der betroffene Partner entwickelt keinerlei Krankheitseinsicht. In vielen Fällen erkennt der betroffene Partner seine Abhängigkeit erst, wenn die “Außenwelt” mit harten Maßnahmen reagiert – zum Beispiel der Führerschein entzogen oder der Arbeitsplatz gekündigt wurde – oder der nicht betroffene Partner mit dem Ende der Beziehung droht.
Paarbeziehung bei Abhängigkeit: ein Alltag voller Widersprüche
Abhängigkeit und Sucht führen zu Instabilität und Leid – eine Folge der vielen Widersprüche, die das Zusammenleben erschweren:
- Versprechen und Rückfälle
- Schuldgefühle und Vorwürfe
- Scham und Geheimhaltung
- Liebe und Abwertung
- Hoffnung und Resignation.
Geht das ein paar Jahre lang, dreht sich die Beziehung vor allem die Sucht und ihre Auswirkungen – sie wird zum unsichtbaren Dritten im Raum.
Co-Abhängigkeit
Viele nicht-betroffene Partner geraten ungewollt in eine Co-Abhängigkeit: Sie übernehmen Verantwortung, decken, entschuldigen, retten – und verlieren dabei den Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen. Typisch ist das Gefühl: „Wenn ich mich nur genug anstrenge, wird alles wieder gut.“ Doch diese Dynamik stabilisiert das Suchtverhalten – weil sie den Partner schützt vor unangenehmen Konsequenzen.
Co-abhängiges Verhalten zeigt sich zum Beispiel in:
- Vertuschen des Konsums gegenüber Dritten
- Übernahme aller Pflichten im Haushalt
- Rückzug von Freunden oder sozialen Aktivitäten
- ständiger Wachsamkeit, ob „wieder etwas passiert“
- Vermeidung von Eskalationen um jeden Preis.
EFT-Perspektive: Die Sucht als unterbrochene Bindung
Aus Sicht der Emotionsfokussierten Paartherapie (EFT) wirkt die Abhängigkeit wie eine Ersatzregulation: Der betroffene Partner kompensiert emotionale Unsicherheit, Angst und Selbstwertprobleme über den Konsum. Der Konsum wird zur verlässlichen Quelle von Beruhigung, Entspannung und (scheinbarer) Selbstbestimmung – was aber die emotionale Bindung zur Partnerin / zum Partner schwächt.
Der nicht betroffene Partner wiederum reagiert oft mit Kontrolle, Rückzug oder Vorwürfen – aus Angst und Verzweiflung. So entsteht ein negativer Kreislauf:
- Je instabiler die emotionale Bindung,
- desto mehr rücken die Substanz und ihr Konsum ins Zentrum der Kommunikation.
- Und je stärker der Konsum,
- desto bedrohter wird die Verbindung.
Was Paartherapie leisten kann
- Verständnis schaffen – für beide Seiten. Die Sucht wird als Beziehungsdynamik sichtbar gemacht. Nicht im Sinn von Schuld – sondern im Sinn von Wirkung: Wie reagiert der eine auf das Verhalten des anderen? Was verstärkt was?
- Co-Abhängigkeit erkennen und durchbrechen. Wer als gesunder Partner dauerhaft schützt, entschuldigt und „funktioniert“, kann – oft ungewollt – zur Aufrechterhaltung der Sucht beitragen. In der Paartherapie wird dieser Kreislauf sichtbar: Die Verantwortung für die Sucht liegt beim betroffenen Partner. Der andere trägt Verantwortung für den Umgang damit – aber nicht für das Verhalten selbst. Ziel ist es, sich von übermäßiger Eigenverantwortung zu befreien, Rollenmuster zu klären und neue Grenzen zu setzen: Unterstützen, ohne zu retten. Lieben, ohne sich selbst zu verlieren.
- Unangenehme Wahrheiten aussprechbar machen. Suchterkrankungen drohen immer, nicht nur den Betroffenen, sondern auch sein Umfeld ins Unglück zu stürzen. Dieses im Raum stehende Unglück gibt dem nicht betroffenen Partner das Recht, das Fortbestehen der Beziehung von Fortschritten beim Loskommen von der Sucht abhängig zu machen. Die Paartherapie kann helfen, diese sehr schwierigen Themen respektvoll zu besprechen.
- Fähigkeit wiederherstellen, über Emotionen zu sprechen. Schweigen, Angst und Eskalation prägen oft die Kommunikation. EFT bietet einen Weg zurück zu einer Sprache, in der Emotionen und Verletzlichkeit gezeigt – und Beziehung wieder erlebbar wird.
- Beziehungsgrenzen klären – auch als Schutz. Was kann noch mitgetragen werden? – Und was nicht mehr? Die Paartherapie ist auch ein Raum, in dem realistische Absprachen entstehen: über Alkohol im Haus, über Lügen, über Verbindlichkeit.
- Kein Ersatz für Entzug – aber eine stabile Basis. Paartherapie ersetzt nicht die medizinische oder suchttherapeutische Behandlung – aber sie kann helfen, Rückfälle zu verhindern, Co-Abhängigkeit zu durchbrechen und die Beziehung wieder zu stabilisieren. Wenn der süchtige Partner sich in Behandlung begibt, kann die Paartherapie ihn (und die Beziehung) begleiten – nicht therapieren.
Fazit
Suchterkrankungen bedrohen nicht nur die Betroffenen, sondern auch ihr Umfeld – meist über Jahre. Klug ist, wer als nicht betroffener Partner frühzeitig reagiert, einen Entzug einfordert – und das Fortbestehen der Beziehung in Frage stellt, falls Fortschritte beim Ausstieg ausbleiben.
Paartherapie kann diesen Prozess unterstützen, sie ist aber kein Heilmittel. Sie ist wichtig, weil sie dem nicht betroffenen Partner Werkzeuge an die Hand gibt, sich nicht mitreißen zu lassen – und sich innerlich nicht aufzugeben.
Die eigentliche Arbeit an der Sucht muss der betroffene Partner selbst leisten – in einer geeigneten medizinischen oder suchttherapeutischen Behandlung.

Paartherapie in Augsburg
Manchmal braucht es nur einen ersten Schritt, um wieder zueinanderzufinden. Meldet euch gerne und wir schauen gemeinsam, wie ich euch unterstützen kann.
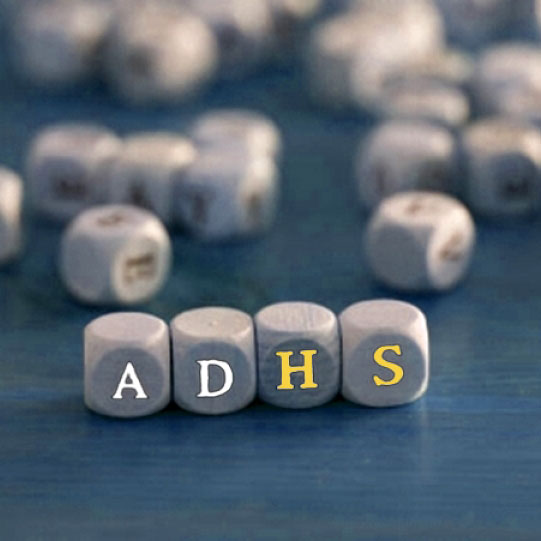
Paartherapie bei einem Partner mit ADHS und ADS
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung) und ADS (Aufmerksamkeitsdefizitstörung ohne ausgeprägte Hyperaktivität) sind neurobiologische Entwicklungsstörungen, die meist schon in der Kindheit beginnen und zu etwa 50 % im Erwachsenenalter bestehen bleiben.
- ADHS ist geprägt von Unaufmerksamkeit, Impulsivität und motorischer Unruhe.
- ADS zwar keine motorische Unruhe, dafür vor allem Unaufmerksamkeit und Schwierigkeiten bei der Konzentration.
- Beide Formen beeinflussen das Denken, Fühlen und Handeln — und wirken sich daher stark auf die Partnerschaft aus.
Typische Symptome in der Paarbeziehung
- Vergesslichkeit und Chaos: Termine werden vergessen, Verabredungen nicht eingehalten, Absprachen gehen unter – nicht aus Gleichgültigkeit, sondern durch Reizüberflutung.
- Unaufmerksamkeit im Gespräch: Der betroffene Partner wirkt häufig abwesend oder verliert den Faden. Das kann als Desinteresse oder emotionale Kälte fehlgedeutet werden.
- Impulsivität: Unüberlegte Aussagen oder abrupte Stimmungsschwankungen führen zu Konflikten – oft ohne böse Absicht.
- Desorganisation im Alltag: Haushalt, Finanzen oder Familienmanagement liegen zunehmend beim gesunden Partner – der sich alleingelassen fühlt.
- Eskalierende Kleinkonflikte: Streit um Ordnung, Pünktlichkeit oder Versäumnisse nimmt überhand – während zentrale Themen kaum noch besprochen werden.
Bindungsdynamik aus Sicht der EFT
In der Emotionsfokussierten Paartherapie (EFT) zeigt sich: Für den nicht betroffenen Partner entsteht häufig das Gefühl, emotional nicht erreichbar zu sein – weil der ADHS-Partner mit seiner Aufmerksamkeit oft woanders ist, abgelenkt oder innerlich überfordert. Auf der anderen Seite erlebt der ADHS-Partner sich selbst häufig als kritisiert oder nie „gut genug“ – was wiederum zu Rückzug oder Gegenangriff führen kann.
So entsteht ein Teufelskreis:
- Der ADHS-Partner zeigt Desorganisation oder Unaufmerksamkeit → der andere fühlt sich überlastet oder nicht ernst genommen
- Der nicht betroffene Partner reagiert mit Kontrolle, Kritik oder Rückzug
- Der ADHS-Partner fühlt sich dadurch noch weniger gesehen oder überfordert – und zieht sich weiter zurück
- Beide fühlen sich verletzt – und unverstanden.
Was Paartherapie leisten kann:
- Psychoedukation: Die Symptome richtig deuten lernen. Der erste Schritt ist oft das gemeinsame Verständnis: Was gehört zur Persönlichkeit – und was ist durch die ADHS-Symptomatik erklärbar? Was ist absichtsvoll – was eher automatisiert oder impulsiv? Dieses Wissen entlastet – und schafft Raum für neue Kommunikation.
- Bindungssicherheit stärken trotz Reizoffenheit. Ziel ist nicht perfekte Organisation – sondern emotionale Verlässlichkeit: Bist du bei mir, wenn ich dich brauche? Nimmst du mich wahr – auch in deinem inneren Trubel?
- Kommunikation strukturieren. Klare Regeln, gezielte Alltagsroutinen und emotionale Check-ins helfen, den Beziehungsraum wieder handhabbar zu machen – für beide Seiten.
- Rollenverteilung entlasten. Der nicht betroffene Partner muss nicht zum „Manager“ werden – sondern darf Aufgaben zurückgeben, z. B. durch klare Aufgabenteilung („Du bist für die Arzttermine verantwortlich – ich erinnere dich nicht mehr“) oder das bewusste Aushalten, dass Dinge nicht perfekt laufen.
- Schnittstelle zur Einzeltherapie oder medikamentösen Behandlung. In der Praxis bewährt sich eine Kombination aus medikamentöser Behandlung (z. B. Methylphenidat), verhaltenstherapeutischer Einzeltherapie und alltagsbezogener Strukturhilfen (z. B. durch ADHS-erfahrene Fachkräfte oder Selbsthilfeangebote).
Fazit
ADHS ist keine Frage des Charakters – aber eine Erkrankung, die das Verhalten oft stark verzerrt. Für die Partnerschaft bedeutet das: klare Kommunikation, gegenseitige Entlastung – und der Aufbau neuer Verlässlichkeit. Eine Paartherapie kann dabei helfen – und zugleich die Verbundenheit in der Partnerschaft vertiefen.
Paartherapie bei einem Partner mit Persönlichkeitsstörung
Persönlichkeitsstörungen sind übermäßige Ausprägungen von Charaktereigenschaften mit oft unflexiblen, starren und unzweckmäßigen Zügen. Persönlichkeitsstörungen sind sehr häufig, 8-10 % der Erwachsenen sind betroffen.
Viele Persönlichkeitsstörungen gibt es in einem Kontinuum zwischen kaum wahrnehmbar bis hin zu gewalttätigem, antisozialen oder selbstschädigenden Verhalten. Deshalb ist es nicht leicht, allgemeine Ratschläge zu geben, wozu Persönlichkeitsstörungen in einer Beziehung führen.
Auch zeigen sich je nachdem, welche Persönlichkeitsstörung vorliegt, sehr unterschiedliche Symptome. In vielen Fällen erleben die betroffenen Paare einen hohen Leidensdruck, der über Jahre bestehen kann. Die Beziehung leidet – oft ohne dass das Störungsbild als solches erkannt oder verstanden wird. Nicht selten ist die Partnerin oder der Partner derjenige, der schließlich Hilfe sucht.
In der Paartherapie geht es nicht darum, Persönlichkeitszüge zu „heilen“, sondern die Beziehung zu stabilisieren – durch ein besseres Verständnis der Muster, durch emotionale Entlastung und durch klare, tragfähige Absprachen.
EFT-Perspektive: Wenn Bindung Verletzung bedeutet
Nähe als Bedrohung. Aus Sicht der emotionsfokussierten Paartherapie (EFT) zeigt sich: Viele Menschen mit Persönlichkeitsstörungen erleben Nähe nicht als Sicherheit – sondern als potenzielle Bedrohung. Entsprechend sind ihre Reaktionen auf gesuchte Nähe entweder übersteuert (z. B. Wut, Rückzug, Kontrolle) oder unterdrückt (z. B. emotionale Leere, Erstarren)
Die zentrale Frage der EFT: Ist es sicher, mich auf dich zu verlassen?
- mit Rückzug – aus Selbstschutz, was die Angst des anderen verstärkt
- oder mit Überanpassung – aus Sorge, was wiederum Autonomie oder Respekt untergräbt
Beides kann zum Teufelskreis werden – ohne dass die Partner verstehen, was da eigentlich passiert.
Da jede Persönlichkeitsstörung über diesen allgemeinen Mechanismus hinaus sehr verschiedene Auswirkungen auf die Partnerschaft hat, hier die differenzierte Betrachtung der wichtigsten Persönlichkeitsstörungen, wie sie sich in der Paarbeziehung bemerkbar machen und was eine Paartherapie bewirken kann:

Paranoide Persönlichkeitsstörung in der Paarbeziehung
Betroffene sind dauerhaft misstrauisch, überempfindlich gegenüber Kränkungen und neigen dazu, selbst harmlose Äußerungen als Angriff zu werten. In Paarbeziehungen äußert sich das durch:
- ständige Verdächtigungen
- unbegründete Eifersucht
- Unterstellungen, der Partner sei untreu oder unehrlich
- chronische Gereiztheit bei vermeintlicher Respektlosigkeit
Der Partner fühlt sich häufig „auf dünnem Eis“, da normale Kritik sofort als Entwertung erlebt wird. Nähe ist möglich, aber brüchig – weil das Grundvertrauen fehlt.
Was hilft?
- Struktur und Vorhersehbarkeit: feste Rituale, klare Absprachen
- Transparente Kommunikation – keine versteckten Botschaften
- Keine Eskalation: Kritik immer als Ich-Botschaft, mit Fokus auf konkretes Verhalten
- Langsamer Vertrauensaufbau – durch kleine, vorhersehbare Alltagserfahrungen, in denen Sicherheit spürbar wird. Zum Beispiel: Der gesunde Partner erzählt etwas Persönliches – ohne Angst, dass es gegen ihn verwendet wird. Der betroffene Partner hat gelernt, zuzuhören, ohne sofort zu kommentieren. Solche Erlebnisse zeigen dem gesunden Partner: „Ich bin dir nicht ausgeliefert – du bist berechenbar und wohlwollend.“
- In der EFT-Arbeit: Erkennen des Bindungsbedürfnisses hinter dem Misstrauen.
Schizoide Persönlichkeitsstörung in der Paarbeziehung
Menschen mit schizoider Persönlichkeitsstörung wirken emotional distanziert, kühl, kontaktscheu – oft ohne subjektives Leiden. Das Alleinsein wird bevorzugt, Kuscheln, Streicheln und Sex sind häufig sekundär oder nicht gewünscht.
Der nicht betroffene Partner empfindet die Beziehung oft als leer, einseitig oder sogar beziehungslos – obwohl formale Verlässlichkeit (z. B. im Alltag) durchaus gegeben ist.
In der Beziehung ist der nicht-betroffene Partner oft extrem frustriert: die erlebte Kälte und Distanziertheit in Kombination mit einem minimalen Kommunikationsbedürfnis und kaum gezeigten Gefühlen sind nur schwer zu ertragen.
Was hilft?
- Akzeptieren, dass emotionale Expressivität nicht oder nur in reduziertem Maß erreichbar ist
- Feste Strukturen und gemeinsam getragene Routinen (z. B. Spaziergang statt „Reden über Gefühle“)
- Klare Kommunikation über Bedürfnisse – auch wenn Reaktion zurückhaltend bleibt
- In der Paartherapie kann die Nähe wohldosiert geübt werden: etwa durch vorsichtige Gespräche über Gefühle; Blickkontakt halten, ohne zu drängen; Berührungen, die angekündigt und respektvoll angeboten werden; gemeinsame Rituale wie schweigend spazieren gehen.
- Ziel ist Nähe zu schaffen ohne emotionale Überforderung. Viele Paare setzen Nähe mit emotionaler Tiefe und Intensität gleich. Das funktioniert bei schizoiden oder auch ängstlich-vermeidenden Persönlichkeitszügen aber nicht – diese Menschen ziehen sich zurück, wenn es zu eng wird. Besser ist, wenn …
- … Sicherheit durch Verlässlichkeit, Vorhersagbarkeit und emotionale Ruhe entsteht. Beispiel: Ein Paar sitzt morgens gemeinsam am Tisch. Der schizoide Partner liest Zeitung, der andere trinkt Kaffee. Kein Gespräch – aber eine stille, gemeinsame Routine. Später lobt der nicht-betroffene Partner: „Ich mag diese ruhigen Morgen mit dir – ganz ohne viele Worte.“

Dissoziale Persönlichkeitsstörung (= antisoziale Persönlichkeitsstörung) in der Paarbeziehung
Die dissoziale Persönlichkeit zeigt sich in mangelnder Empathie, Impulsivität, Aggressivität und in der Tendenz, andere zu manipulieren oder auszunutzen. Häufig besteht ein Muster von Lügen, Regelverstößen oder grenzüberschreitendem Verhalten – auch gegenüber dem Partner.
In der Beziehung sind Partner mit antisozialen Persönlichkeitsmerkmalen äußerst herausfordernd. Erstaunlicherweise verhalten sich Menschen mit antisozialen Zügen während der Partnersuche oft sehr strategisch: Sie spüren schnell, wer einsam oder auf der Suche nach Bindung ist, können sich anfangs charmant und zugewandt zeigen – und machen ihre frisch gewonnenen Partner:innen durch wechselnde Nähe und Distanz gefügig. Dieses Verhalten bindet – aber auf manipulativer Grundlage. Nicht selten tritt im Verlauf der Beziehung psychische oder körperliche Gewalt auf.
Typische Beziehungsmuster:
- Manipulation und Lügen zum eigenen Vorteil
- Abwertung, Schuldumkehr, emotionale Abhängigkeit
- Vernachlässigung oder Ausnutzung familiärer oder finanzieller Ressourcen
- Hohe Reizbarkeit, Gewaltandrohung oder tatsächliche Übergriffe
Was hilft – und was nicht
- In der Regel keine Paartherapie – außer unter klaren Schutzbedingungen, z. B. kein aktuelles Gewaltverhalten, therapeutische Einsicht, externe Kontrolle durch Gerichte, Sozialarbeit oder Beratungseinrichtungen.
- Fokus auf Grenzsetzung statt auf „Harmonisierung“
- Starke Orientierung an konkreten Vereinbarungen (z. B. Verantwortung für Geld, Kinder, Wohnsituation)
- Einbindung von Fachstellen (z. B. Schuldnerberatung, Täterarbeit bei Gewalt)

Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) in der Paarbeziehung
Borderline-Störungen sind gekennzeichnet durch Instabilität in Selbstbild, Affekten und Beziehungen. Die Beziehung ist häufig geprägt von:
- stark wechselhafte Stimmungen und Beziehungsverhalten
- Trennungsdrohungen, Suizidankündigungen, Selbstverletzungen
- ständige Rückversicherung: „Liebst du mich noch?“ – gefolgt von plötzlicher Abwehr
- impulsives Verhalten in den Bereichen Geld, Sexualität, Drogen, Essen
- intensive Reaktionen auf vermeintliche Zurückweisung oder Kritik
In der Beziehung fallen Partner mit Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) sofort auf durch ihre starken Stimmungsschwankungen. Diese emotionalen Extreme wechseln innerhalb kurzer Zeitspannen von tiefen Depressionen zu intensiver Euphorie, was für Partner verwirrend und schwer zu handhaben ist. Die Angst vor Nähe aber auch vor Ablehnung verhindern, dass der Partner mit BPS dauerhaftes Vertrauen und echte Nähe in der Beziehung aufbaut.
Was hilft?
- Klar strukturierte Beziehung (z. B. feste Rituale, emotionale Vereinbarungen)
- Stabile Abgrenzung ohne emotionale Kälte Transparenz über Reaktionen: „Ich sehe, dass du leidest – aber ich trage nicht allein die Lösung.“
- Entlastung des nicht betroffenen Partners von übermäßiger Verantwortung
- In der EFT-Paartherapie: Sichtbarmachen der emotionalen Verletzlichkeit, die hinter den starken Reaktionen steckt – z. B. Angst vor Ablehnung, Scham, das Gefühl „nicht gut genug“ zu sein
Wichtig: Die Paartherapie kann nur greifen, wenn parallel eine Einzeltherapie der betroffenen Person erfolgt – bevorzugt nach dem Ansatz der Dialektisch-Behavioralen Therapie (DBT), die auf Stabilisierung, Emotionsregulation und soziale Kompetenzen fokussiert.
Zudem ist wichtig, dass der nicht-betroffene Partner auf seine eigene psychische Gesundheit achtet – sei es durch eigene Psychotherapie, Selbsthilfegruppen oder seine Freundschaften und Netzwerke. Nur wenn auch dieser Teil des Systems tragfähig bleibt, kann eine Paartherapie überhaupt wirksam sein.

Narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPS) in der Paarbeziehung
Die Narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPS) ist eine Persönlichkeitsstörung, bei der Betroffene ein übersteigertes Bedürfnis nach Bewunderung, mangelndes Einfühlungsvermögen und ein grandioses Selbstbild zeigen. Hinter der Fassade liegen oft tiefe Unsicherheiten und Angst vor Kritik.
- Intime Beziehungen sind oft schwierig aufgrund der Angst vor Ablehnung oder Schwäche
- Ununterbrochenes Suchen nach Aufmerksamkeit und Anerkennung Anderer
- Mit dem Älterwerden wachsen die Probleme. Existenzielle Krisen und Suizide sind häufig.
In der Beziehung zeigt sich die narzisstische Persönlichkeit durch:
- starke Ich-Bezogenheit, wenig Interesse an den Gefühlen des Partners
- ständiges Bedürfnis nach Bestätigung, Lob und Bewunderung
- das gezielte Ausnutzen der Stärken oder Schwächen des anderen
- aggressive oder abwertende Reaktionen auf Kritik
- wiederkehrende emotionale Manipulationen wie Schuldumkehr und Gaslighting.
Für den nicht-narzisstischen Partner fühlt sich die Beziehung oft wie eine Einbahnstraße an: Nähe entsteht nur, wenn er Bewunderung liefert – aber echte Gegenseitigkeit fehlt. Wird Kritik geäußert, reagiert der narzisstische Partner häufig verletzt oder aggressiv. Rückzug des anderen wird nicht als Selbstschutz verstanden, sondern als illoyale Strafe. In der Folge ziehen sich beide zurück – einer aus Enttäuschung, der andere aus Gekränktheit.
Was hilft – wenn Veränderung beidseits gewünscht ist:
- Aufbau einer kontrollierten, wertschätzenden Therapiebeziehung
- klare Kommunikationsregeln: Ich-Botschaften statt Schuldzuweisungen. Also nicht: „Du bist so egoistisch!“, sondern: „Ich fühle mich oft übergangen, wenn meine Bedürfnisse nicht vorkommen.“ – das reduziert Eskalation und ermöglicht, die eigene Perspektive verständlich zu machen.
- Feedback mit Fokus auf Verhalten, nicht auf Identität
- In der EFT-Arbeit: Heranführen an die „verletzliche Seite hinter der Maske“ – z. B. die tiefe Angst vor Bedeutungslosigkeit oder Schwäche
- Parallel dazu: Stärkung des nicht-betroffenen Partners in der Selbstwahrnehmung und Abgrenzung.

Ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung in der Paarbeziehung (= Selbstunsichere Persönlichkeitsstörung)
Die Ängstlich-vermeidende Persönlichkeit ist geprägt von übermäßiger Empfindlichkeit gegenüber Kritik, tiefem Gefühl von Unzulänglichkeit und der chronischen Angst, anderen zur Last zu fallen oder sich in der Beziehung „zu viel“ zuzumuten.
In der Beziehung fallen ängstlich-vermeidende Partner auf
- durch emotionale Distanz
- durch Angst vor Nähe und emotionaler Intimität, was die Beziehung besonders im Bereich körperlicher Nähe und Sex überschattet.
- durch Konfliktvermeidung in der Kommunikation mit dem nicht-betroffenen Partner.
- durch Schwierigkeiten, offen über ihre Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle zu sprechen.
Der gesunde Partner spürt Nähe, aber nicht Verbindlichkeit – erlebt Rückzug statt Auseinandersetzung. Es entsteht oft ein Gefühl, „alles alleine tragen zu müssen“.
Was hilft?
Themen einer Paartherapie umfassen:
- die behutsame Exploration der Angst „nicht gut genug“ zu sein
- die Förderung von Verlässlichkeit durch kleine emotionale Signale
- das Thema Nähe ohne emotionale Überforderung. In vielen Paaren wird Nähe mit emotionaler Tiefe und Intensität gleichgesetzt. Das funktioniert bei ängstlich-vermeidenden Persönlichkeitszügen nicht – diese Menschen ziehen sich zurück, wenn es zu eng wird. Stattdessen:
- Sicherheit durch Verlässlichkeit, Vorhersagbarkeit und emotionale Ruhe schaffen. Beispiel: Ein Paar sitzt morgens gemeinsam am Tisch. Der schizoide Partner liest Zeitung, der andere trinkt Kaffee. Kein Gespräch – aber eine stille, gemeinsame Routine. Später sagt der nicht-betroffene Partner ruhig: „Ich mag diese ruhigen Morgen mit dir – auch ohne viele Worte.“
- die Unterstützung des gesunden Partners darin, aus der Retterrolle herauszutreten
- in der EFT: behutsame Exploration der Angst, nicht genug zu sein – und gezielte Verstärkung erlebter emotionaler Sicherheit in der Partnerschaft
- die Entlastung des gesunden Partners von der Rolle des „Mitdenkers“ oder „Vorreiters“ – klare Absprachen statt ständiger Anpassung.
Zwanghafte Persönlichkeitsstörung (= Anankastische Persönlichkeitsstörung) in der Paarbeziehung
Zwanghafte Persönlichkeiten streben nach Kontrolle, Ordnung, Perfektion – auch und gerade im Zwischenmenschlichen. Sie haben oft Schwierigkeiten mit Flexibilität, Nähe und Spontaneität, weil alles kontrollierbar bleiben muss.
In der Beziehung zeigt sich das durch:
- hohe Erwartungen an sich und andere, z. B. bei Ordnung, Pünktlichkeit, Verhalten
- übermäßige Beschäftigung mit Regeln und Prinzipien
- geringe Toleranz gegenüber Abweichungen vom Ideal
- Schwierigkeiten mit emotionaler Wärme oder sexueller Spontaneität
- Probleme mit der Arbeitsteilung – weil „nur einer es richtig macht“.
Zwanghafte Partner versuchen, den Partner zu kontrollieren oder zu korrigieren, was zu Frustration und Konflikten führt. Wenig zum Ausdruck gebrachte Emotionen und vorenthaltene Nähe können dazu führen, dass der Partner sich emotional vernachlässigt oder zurückgewiesen fühlt.
Was hilft?
- Entlastung des Partners durch klare Rollenklärung und Absprachen
- Förderung von emotionaler Flexibilität: „Es muss nicht perfekt sein, um wertvoll zu sein.“
- In der EFT-Arbeit: Zugang zu Gefühlen hinter der Kontrolle – z. B. Angst vor Fehlern, Liebesverlust oder Überforderung
- Erlaubnis für Unvollkommenheit – als gemeinsame Aufgabe
- In schwereren Fällen: Kombination mit einzeltherapeutischer Behandlung (z. B. bei Zwangstendenzen)
Statt einer Zusammenfassung
Persönlichkeitsstörungen sind nicht „wegzutherapieren“. Aber Paartherapie kann helfen, die Beziehung trotzdem tragfähig zu gestalten – durch Verständnis, Rollenklarheit, emotionale Sicherheit und realistische Abgrenzung.
Entscheidend ist dabei: Die Partner müssen lernen, mit dem Muster umzugehen – nicht gegeneinander, sondern miteinander.

